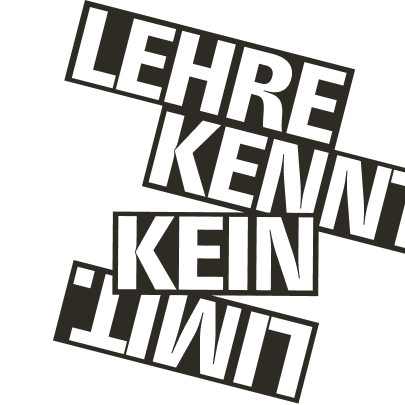Holzblasinstrumentenerzeuger*innen erzeugen, reparieren, warten und restaurieren Blasinstrumente, die aus Holz sind bzw. die ein Mundstück aus Holz bzw. ein einfaches Rohrblatt haben. Dazu gehören Flöten (Blockflöten, Querflöten, Sopran-, Tenor-, Bassflöten), Klarinetten, Oboen, Fagotte, Englischhörner und Saxophone.
Holzblasinstrumentenerzeuger*innen fertigen Skizzen an und stellen Schablonen her. Sie verarbeiten exklusive Hölzer und Metalle. Dabei drechseln sie das Holz, bohren, schleifen und fräsen die Klanglöcher und beizen oder lackieren die Oberflächen. Sie löten und schmieden die Metallteile. Der überwiegende Teil der Holzblasinstrumentenerzeuger*innen arbeitet gemeinsam mit ihren Kolleg*innen und Vorgesetzten in den Werkstätten von Kleinbetrieben.
Wo man arbeitet
Zur Familie der Holzblasinstrumente gehören sehr unterschiedliche Instrumente – auch solche, die man auf den ersten Blick nicht dazu zählen würde wie z. B. Klarinetten, Querflöten, Oboen oder Fagotte, d. h. viele Holzblasinstrumente sind aus einer Mischbauweise aus Holz und Metall gefertigt. Der Klassiker der Holzblasinstrumente ist natürlich die Blockflöte.
Holzblasinstrumentenerzeuger*innen fertigen zunächst Skizzen und Werkzeichnungen der einzelnen Instrumententeile an bzw. fertigen die Instrumente gemäß bestehenden Standardmodellen. Für die Produktion von Holzblasinstrumenten werden Edelhölzer aus Europa, Afrika und Mittelamerika verwendet (z. B. Ahorn, Birke, Rosenholz). Weiters arbeiten sie auch mit Metall und Metalllegierungen, Kunststoffen und Kautschuk.
Nach dem Messen, Anzeichnen, Anreißen und Zuschneiden der Werkstücke beginnen sie mit der Formgebung der einzelnen Instrumententeile. Hölzerne Teile drechseln sie an der Drehmaschine grob heraus, bohren das Klangloch („Mensur“), schleifen es mit einem speziellen Werkzeug („Räumer“) aus und fräsen die Tonlöcher. Anschließend erfolgt die endgültige Formung des Werkstückes durch Feindrehen („Fassonieren“) sowie die Oberflächenveredlung durch Schleifen, Beizen, und Lackieren. Instrumententeile aus Metall werden durch Biegen, Drehen, Schmieden und Löten des Rohstückes hergestellt und einer Oberflächenbehandlung durch Polieren, Mattieren oder auch Galvanisieren (Auftragen eines Metallüberzuges durch elektrischen Strom) unterzogen.
Da die Produktion von Holzblasinstrumenten in Österreich in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen ist, beschränken sich die Aufgaben heute meist auf die Bereiche Reparatur und Wartung. Während billige Lerninstrumente in maschineller Serienproduktion erzeugt werden, beschränkt sich die Inlandsfertigung auf die Herstellung von Qualitätsinstrumenten für Berufsmusiker*innen.
Womit man arbeitet
Holzblasinstrumentenerzeuger*innen arbeiten mit unterschiedlichen Hand- und Maschinenwerkzeugen für die Holz- und Feinblechbearbeitung (z. B. Dreh- und Drückbänke, Dreh-, Schleif- und Poliermaschinen, Fräsen, Lötkolben). Für die Oberflächenveredelung verwenden sie verschiedenste Beizen, Harze und Lacke, die mit Pinseln und Tüchern aufgetragen werden. Zum Stimmen der Instrumente werden Stimmgeräte mit meist computerunterstützten Messverfahren eingesetzt.
Wie man arbeitet
Holzblasinstrumentenerzeuger*innen arbeiten gemeinsam mit ihren Kolleg*innen und Meistern in den Werkstätten ihrer Betriebe. Bei speziellen Einzelanfertigungen besprechen sie die Aufträge mit ihren Auftraggeber*innen (z. B. °Instrumentalmusiker*in#nen). Im Verkauf beraten sie ihre Kund*innen. Sie haben außerdem Kontakt zu ihren Lieferant*innen und je nach Größe und Art des Betriebs zu Mitarbeiter*innen des Musikalienhandels sowie zu Kolleg*innen, die in der Herstellung anderer Instrumente oder von Instrumentenzubehör tätig sind.
Weitere Lehrberufe des Musikinstrumentenbaus sind:
- °Streich- und Saiteninstrumentenbau – Streichinstrumente (Lehrberuf)#
- °Streich- und Saiteninstrumentenbau – Zupfinstrumente (Lehrberuf)#
- °Streich- und Saiteninstrumentenbau – Bogen (Lehrberuf)#
- °Harmonikamacher*in (Lehrberuf)#
- °Klavierbau (Lehrberuf)#
- °Blechblasinstrumentenerzeugung (Lehrberuf)# und
- °Orgelbau (Lehrberuf)#
Was man macht
- technische Unterlagen, Pläne und Werkzeichnungen lesen und anwenden
- Arbeitsschritte, Arbeitsmittel und Arbeitsmethoden festlegen
- Arbeitsabläufe planen und steuern, Arbeitsergebnisse beurteilen
- Werkstoffe und Hilfsstoffe fachgerecht auswählen, überprüfen und entsorgen
- Werkstoffe (Metall, Holz, Kunststoff, Filz und Leder) unter Berücksichtigung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften, Normen und Sicherheitsstandards bearbeiten
- Holzblasinstrumente und Holzblasinstrumententeile anfertigen und einbauen
- Holzblasinstrumente warten, reparieren und restaurieren
- Funktionsprüfung und Qualitätskontrolle fachgerecht durchführen
- Oberflächen behandeln
- Dokumentationen über Arbeitsabläufe erstellen
- Kund*innen beraten
Für wen man arbeitet
- Kleinbetriebe des Holzblasinstrumentenerzeugergewerbes
- In seltenen Fällen können sie auch als Instrumenten- bzw. Orchesterwarte an Konservatorien oder Theatern Beschäftigung finden.
Ausbildungsinhalte / Was man lernt
Wichtige Ausbildungsinhalte:
- Instrumentenbau
- Holzblasinstrumentenerzeugung
- Arbeitsvorbereitung
- Werkskizzenerstellung, von Hand und mit CAD
- Maschinen- und Gerätekunde
- Werkzeug- und Materialienkunde
- Fertigungstechniken
- Wartung und Reparatur
- Instrumentenhandel
- Betriebsführung, Buchführung
- Kund*innenberatung und -betreuung
Wie man sich weiterbilden kann
Holzblasinstrumentenerzeuger*innen sind beruflich immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Voraussetzung für Erfolg in diesem Beruf ist es, immer auf dem neuesten Stand der Entwicklung zu bleiben und das Fachwissen, die Methodenkompetenzen und sozialen Kompetenzen laufend zu ergänzen und zu vertiefen.
Weiterbildungseinrichtungen wie z. B. das Berufsförderungsinstitut (BFI) und das Wirtschaftsförderungsinstitut (WIFI) bieten Kurse und Lehrgänge in relevanten Bereichen an. Für Holzblasinstrumentenerzeuger*innen können auch Holztechnikkurse (z. B. Kurse über Holzoberflächenbehandlung und -oberflächentechniken) interessant sein. Auch die Vorbereitung auf die Meister*innenprüfung sowie Weiterbildungsangebote in anderen Bereichen der Instrumentenerzeugung kommen als Weiterbildung und Höherqualifizierung in Frage.
Möglichkeiten zur beruflichen Höherqualifizierung bieten außerdem Vorbereitungs- und Aufbaulehrgänge für Berufstätige an berufsbildenden höheren Schulen, insbesondere an Höheren Technischen Lehranstalten (HTL).
Mit dem Abschluss eines Aufbaulehrganges (3 Jahre) ist neben einer höheren Fachqualifikation außerdem die Matura verbunden, die ein Studium an Fachhochschulen und Universitäten (Metallgestaltung, Metalltechnik) ermöglicht.
Studium ohne Matura:
Für ein Studium an einer Fachhochschule, Universität oder Pädagogischen Hochschulen ist normalerweise die Matura einer Allgemeinbildenden (AHS) oder Berufsbildenden Höheren Schule (BHS) erforderlich.
Es bestehen aber auch andere Zugangsmöglichkeiten:
- Berufsreifeprüfung (Lehre mit Matura): Die Berufsreifeprüfung, die du bereits während deiner Lehrzeit beginnen kannst, ist eine vollwertige Matura, mit der du uneingeschränkten Zugang zum Studium hast.
- Studienberechtigungsprüfung: Die Studienberechtigungsprüfung kannst du vor Beginn eines Studiums ablegen. Sie ermöglicht den Zugang zu einem bestimmten Studium.
- ohne Matura mit Berufsausbildung und Berufserfahrung: Fachhochschulen bieten außerdem meist die Möglichkeit mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung (insb. Lehre oder Berufsbildender Mittlerer Schule (BMS)) und mehrjähriger Berufserfahrung auch ohne Matura ein facheinschlägiges (d. h. mit der Berufsausbildung fachlich verwandtes) Bachelorstudien zu beginnen. Meist müssen dazu einzelne Zusatzprüfungen absolviert werden.
Weiterführende Bildungsmöglichkeiten und Höherqualifizierung:
Was du mitbringen solltest
In jedem Beruf brauchst du spezielles fachliches Know-how, das in der Aus- und Weiterbildung vermittelt wird. In den beiden Menüpunkten Ausbildung und Weiterbildung findest du Informationen zu Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für diesen Beruf.
Es gibt auch Kompetenzen, Fähigkeiten und Eigenschaften, die in allen Berufen wichtig sind. Dazu gehören besonders:
- Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit
- genaues und sorgfältiges Arbeiten
- selbstständiges Arbeiten
- Einsatzfreude
- Verantwortungsbewusstsein
- Fähigkeit und Bereitschaft mit anderen zusammen zu arbeiten (Teamfähigkeit)
- Lernbereitschaft
Die folgende Liste gibt dir einen Überblick über weitere allgemeine Anforderungen, die in DIESEM Beruf häufig gestellt werden. Diese können natürlich je nach Betrieb, Institution oder Organisation sehr unterschiedlich sein.
DENK DARAN: Viele dieser Anforderungen sind auch Bestandteil der Ausbildung.
Hinweis: Die Begriffe werden in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.
Körperliche Anforderungen: Welche körperlichen Eigenschaften sind wichtig?
- Auge-Hand-Koordination
- Fingerfertigkeit
- gutes Hörvermögen
Fachkompetenz: Welche Fähigkeiten und Kenntnisse werden von mir erwartet?
- gestalterische Fähigkeit
- gutes Augenmaß
- handwerkliche Geschicklichkeit
- kaufmännisches Verständnis
- räumliches Vorstellungsvermögen
- technisches Verständnis
Sozialkompetenz: Was brauche ich im Umgang mit anderen?
- Kommunikationsfähigkeit
- Kritikfähigkeit
- Kund*innenorientierung
Selbstkompetenz: Welche persönlichen Eigenschaften sollte ich mitbringen?
- Ausdauer / Durchhaltevermögen
- Beurteilungsvermögen / Entscheidungsfähigkeit
- Flexibilität / Veränderungsbereitschaft
- Geduld
- Musikalität
Methodenkompetenz: Welche Arbeits- und Denkweisen sind wichtig?
- Kreativität
- systematische Arbeitsweise
Was es noch gibt
Verwandte Lehrberufe
Durch die Verwandtschaftsregelung wird die Ausbildung in einem Lehrberuf auf Teile der Lehrzeit in anderen (verwandten) Lehrberufen angerechnet. Dadurch verkürzt sich die Lehrzeit bei der Ausbildung in einem weiteren Lehrberuf (oder auch beim Wechsel auf einen verwandten Lehrberuf). In manchen Fällen wird die Lehrzeit und die Lehrabschlussprüfung auch vollkommen ersetzt.
Bei folgenden verwandten Lehrberufen verkürzt sich die Lehrzeit im Ausmaß der angegebenen Lehrjahre. (Beispiel: Der Eintrag „1. voll“ bedeutet z. B., dass sich die Lehrzeit im verwandten Lehrberuf um ein Jahr verkürzt.)
- °Drechsler*in (Lehrberuf – auslaufend)#
- °Harmonikamacher*in (Lehrberuf)#
- °Klavierbau (Lehrberuf)#
- °Kunststoffformgebung (Lehrberuf – auslaufend)#
- °Kunststofftechnologie (Lehrberuf)#
- °Metallbearbeitung (Lehrberuf)#
- °Metalltechnik – Metallbau- und Blechtechnik (Modullehrberuf)#
- °Orgelbau (Lehrberuf)#
- °Streich- und Saiteninstrumentenbau – Bogen (Lehrberuf)#
- °Streich- und Saiteninstrumentenbau – Streichinstrumente (Lehrberuf)#
- °Streich- und Saiteninstrumentenbau – Zupfinstrumente (Lehrberuf)#
- °Tischlerei (Lehrberuf)#
- °Zimmerei (Lehrberuf)#
Alternativen (Auswahl)
Alternative Berufe sind Berufe, die entweder eine ähnliche Ausbildung oder ähnliche Aufgaben- oder Tätigkeitsbereiche haben, wie der Beruf, über den du dich gerade informierst. Die Ähnlichkeit kann auch in den Arbeitsmaterialien, den Arbeitsumgebungen liegen oder in der Art, wie du mit anderen Menschen zusammenarbeitest.
Diese Liste soll dir bei der Überlegung helfen, welche Berufe und Ausbildungen für dich noch interessant sein könnten und dich auf weitere Ideen bringen.
- °Drechsler*in (Lehrberuf – auslaufend)#
- °Harmonikamacher*in (Lehrberuf)#
- °Holzspielzeugmacher*in#
- °Instrumentalmusiker*in#
- °Klavierbau (Lehrberuf)#
- °Kunststoffformgebung (Lehrberuf – auslaufend)#
- °Kunststofftechnologie (Lehrberuf)#
- °Metallbearbeitung (Lehrberuf)#
- °Metalltechnik – Metallbau- und Blechtechnik (Modullehrberuf)#
- °Orgelbau (Lehrberuf)#
- °Produktdesigner*in#
- °Streich- und Saiteninstrumentenbau – Bogen (Lehrberuf)#
- °Streich- und Saiteninstrumentenbau – Streichinstrumente (Lehrberuf)#
- °Streich- und Saiteninstrumentenbau – Zupfinstrumente (Lehrberuf)#
- °Tischlerei (Lehrberuf)#
- °Zimmerei (Lehrberuf)#
Lehre und Matura
Mit einer erfolgreich abgeschlossenen Lehre und vier weiteren Prüfungen erlangst du die Berufsmatura (Berufsreifeprüfung). Diese öffnet dir den Zugang zu Universitäts- und Fachhochschulstudien. Außerdem ermöglicht sie zusätzliche Karrierewege im erlernten Beruf, aber auch außerhalb des bisherigen Berufsfeldes.
Und so geht es:
Die Berufsmatura besteht aus vier Teilprüfungen: Deutsch (schriftlich und mündlich) und Mathematik (schriftlich), eine lebende Fremdsprache (schriftlich oder mündlich) und ein Fachbereich (schriftliche Prüfung oder Projektarbeit und mündliche Prüfung). Der Fachbereich ist ein Thema aus dem Berufsfeld des Kandidaten/der Kandidatin.
Wie funktioniert die Vorbereitung?
Die Vorbereitung auf die Berufsreifeprüfung erfolgt in Vorbereitungskursen, die von Erwachsenenbildungseinrichtungen (z. B. WIFI, BFI, Volkshochschulen), Berufsschulen oder höheren Schulen (z. B. AHS, HAK, HTL, HLW) angeboten werden. In solchen Lehrgängen können auch die jeweiligen Teilprüfungen abgelegt werden. Drei der vier Teilprüfungen können bereits während der Lehre abgelegt werden. Zur letzten Teilprüfung kannst du nach erfolgreichem Lehrabschluss, aber nicht vor dem 19. Geburtstag antreten.
Durch ein Förderprogramm, können die Vorbereitungskurse und die Prüfung seit September 2008 in ganz Österreich kostenlos angeboten werden. Zur konkreten Ausgestaltung der Vorbereitung auf die Berufsreifeprüfung bestehen in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Modelle. Informationen bieten u. a. die Bildungseinrichtungen und die Lehrlingsstellen der Wirtschaftskammern.
Link: Häufig gestellte Fragen!
WKO-Bildungspfade:
Die WKO-Bildungspfade geben dir einen Überblick über durchgängige Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten in unterschiedlichen Berufen am Beispiel der WKO Bildungsangebote. Der Bildungspfad Berufsreifeprüfung steht in allen Lehrberufen offen:
Selbstständigkeit
Selbstständigkeit
Die Möglichkeit einer selbstständigen Berufsausübung ist gegeben durch:
Reglementierte Gewerbe/Handwerke:
- Handwerk der Holzblasinstrumentenerzeuger, BGBl. II Nr. 72/2003 (Novelle Art. 34, BGBl. II Nr. 399/2008)
Für die Ausübung eines reglementierten Gewerbes sind, neben der Erfüllung der allgemeinen Voraussetzungen, Befähigungsnachweise zu erbringen, die in den angeführten Bundesgesetzblättern festgelegt sind.
Downloadmöglichkeit der Zugangsvoraussetzung und Prüfungsordnungen (Bundesgesetzblätter): Wirtschaftskammer Österreich: Prüfungs- und Befähigungsnachweise für reglementierte Gewerbe.
ALLGEMEINE HINWEISE:
Für jede Tätigkeit, die Sie selbstständig, regelmäßig und mit der Absicht, Gewinn zu erzielen, ausüben wollen, brauchen Sie eine Gewerbeberechtigung (Ausnahme: Freie Berufe). Diese erhalten Sie durch Anmeldung bei der Gewerbebehörde (Bezirkshauptmannschaft, Magistrat).
Unabhängig von einem etwaigen Befähigungsnachweis müssen Sie dafür folgende Voraussetzungen erfüllen:
- das 18. Lebensjahr muss vollendet sein
- österreichische Staatsbürgerschaft oder Staatsbürgerschaft eines anderen EU-Mitgliedstaates (oder eines Staates, mit dem ein entsprechender Staatsvertrag besteht) oder es liegt ein gültiger Aufenthaltstitel vor, der zur selbstständigen Tätigkeit berechtigt
- keine Ausschließungsgründe (z. B. abgewiesene Konkursanträge, Bestrafung wegen Finanzstrafdelikten)
In allen Fällen einer selbstständigen Berufsausübung (ob im Rahmen eines Gewerbes oder als freiberufliche Tätigkeit) ist diese bei der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft und dem zuständigen Finanzamt zu melden.
Weitere Informationen und Kontakte:
- Weitere Informationen über die Gewerbeordnung, Befähigungsnachweise, Kontaktmöglichkeiten usw. finden Sie unter Wirtschaftskammer Österreich – Gewerberecht.
- Weitere Informationen zur Unternehmensgründung, Kontaktmöglichkeiten usw. finden Sie unter Gründerservice der Wirtschaftskammer Österreich.