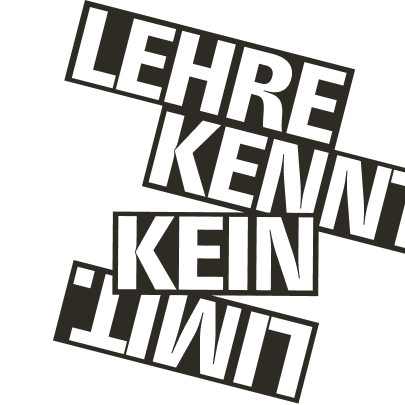Der Ausbau moderner Bahnstrecken, die auch den besonderen Ansprüchen von Hochgeschwindigkeitszügen gerecht werden, ist für Bahnlinien eine wesentliche Aufgabe. Gleisbautechniker*innen sind die Expertinnen und Experten, die diesen Ausbau vorantreiben und gleichzeitig bestehende Streckennetze betreuen und erhalten. Sie führen erforderliche Vermessungsarbeiten an den Bahnstrecken durch, richtigen die Baustellen ein und sichern diese ab. Zur Baustelleneinrichtung gehört auch die Mithilfe bei der Anlieferung und Lagerung der notwendigen Maschinen und Materialien (Schüttgut, Fertigteile, Gleis- und Weichenroste usw.).
Da Gleisbauarbeiten häufig während des laufenden Fahrbetriebes erfolgen, hat die Absicherung der Baustelle ganz besonders große Bedeutung. Dazu stellen sie gut sichtbare und funktionierende Signale auf, wie Langsamfahr- und Sperrsignale, Pfeifpflöcke und Signale für Schneeräumfahrten und montiert Signal-, Geschwindigkeitsanzeiger und -voranzeiger, festen Absperrungen und anderen Sicherheitsvorkehrungen.
Die Arbeit von Gleisbautechniker*innen konzentriert sich vor allem auf den Gleisoberbau. Die Beurteilung des bereits vorhandenen oder neu hergestellten Gleisunterbau bildet dazu eine wichtige Grundlage. Bei bestehenden Unterbauten muss insbesondere beurteilt werden, in welchem Umfang Erneuerungen und Sanierungen und beispielsweise Entwässerungen und Drainagierungen erforderlich sind. Auf dem Fundament bauen Gleisbautechniker*innen Bahndämme, Brücken, Überführungen und Durchlässe. Im Oberbau errichten sie die Bettung (meist aus Schotter) und das Planum (ebene Fläche), verlegen darauf die Schwellen und Schienen sowie Weichen, Gleisabschlüsse, Schienenausziehvorrichtungen usw. Sie befestigen die Schienen auf den Schwellen und verschweißen sie miteinander. Dabei beachten sie genauestens die erforderlichen Spur-, Rillen-, Leitweiten und Stoßlücken. Für Hochgeschwindigkeitsstrecken (über 200 km/h) werden Schotterbettungen zunehmend durch feste Bauwesen mit Beton ersetzt (feste Fahrbahnen), die einer höheren Beanspruchung standhalten.
Gleisbautechniker*innen stellen aber nicht nur den Schienenstrang selbst her sondern sind auch bei der Errichtung von Bahnsteigen (Herstellung von Bahnsteigkanten), Eisenbahnbrücken, -tunneln, Eisenbahnübergängen und Kreuzungen tätig.
In der Instandhaltung bestehender Streckennetze kontrollieren Gleisbautechniker*innen die Gleisanlagen auf Schwachstellen und führen die nötige Instandsetzung wie z. B. Regulierungen von Spur-, Rillen-, Leitweiten oder Stoßlücken durch. Für Gleisumbauten, die Reinigung und Sanierung von Gleisbetten oder das Abtragen von Gleisanlagen werden großen Bahnbautechnikmaschinen eingesetzt, die viele Arbeitsschritte automatisiert vornehmen und selbst direkt am Gleis fahren. Zu den Tätigkeitsbereichen von Gleisbautechniker*innen gehören aber auch winterdienstliche Arbeiten am Gleiskörper, wie das Beseitigen von Schnee und Eis.
Gleisbautechniker*innen sind genauestens mit den besonderen Betriebsvorschriften der Eisenbahn vertraut. Sie kennen die Signale (z. B. Langsam- und Sperrsignale), die Gleis- und Weichenbezeichnungen, wissen über Eisenbahntechnik und Eisenbahnsicherungstechnik Bescheid (z. B. Spurführung, Rad-Schiene-Problematik) und beherrschen die notwendigen Kommunikationsmittel zur Abwicklung des Bahnbetriebes.